|
 Schon lange gelten Zombies als die Archetypen des Horrorfilms mit dem
denkbar schlechtesten Ruf. Spätestens seit George A. Romero die
Widergänger mit dem ungesunden Appetit auf die Eingeweide der Gattung
Homo Sapiens 1968 in "Night of the living dead" und 1977 in "Dawn of the
dead" auf die (Lebend-Nahrung darstellende) Menschheit losließ, standen
die unbeholfen umherstaksenden, aber oft und gerne herzhaft zubeißenden
Untoten synonym für Horrorfilme, die statt intelligentem Schauer immer
exorbitantere blut- und hirnverspritzende Schreckensspektakel
veranstalteten und sich scheinbar allein das Auslösen eines möglichst
heftigen Brechreizes zum Ziel gesetzt hatten.
Schon lange gelten Zombies als die Archetypen des Horrorfilms mit dem
denkbar schlechtesten Ruf. Spätestens seit George A. Romero die
Widergänger mit dem ungesunden Appetit auf die Eingeweide der Gattung
Homo Sapiens 1968 in "Night of the living dead" und 1977 in "Dawn of the
dead" auf die (Lebend-Nahrung darstellende) Menschheit losließ, standen
die unbeholfen umherstaksenden, aber oft und gerne herzhaft zubeißenden
Untoten synonym für Horrorfilme, die statt intelligentem Schauer immer
exorbitantere blut- und hirnverspritzende Schreckensspektakel
veranstalteten und sich scheinbar allein das Auslösen eines möglichst
heftigen Brechreizes zum Ziel gesetzt hatten.
Nach der ersten und primitivsten Zombie-Welle in den 80ern konnten auch
verbesserte Tricktechnik und geringfügig intelligentere Drehbücher wenig
an dem ruinierten Ruf retten. Nach Peter Jacksons grandioser
Splatter-Groteske "Braindead" schien 1992 zum Thema der lebenden Toten
schlicht und einfach alles gesagt oder besser gefilmt worden zu sein,
und die unappetitlich anzusehenden Menschenfresser verschwanden
endgültig im Underground billigster Independent- und
Direct-to-Video-Produktionen. Umso gespannter richteten sich die
Erwartungen auf die Computerspielverfilmung "Residen t Evil", mit der
sich Regisseur Paul Anderson anschickte, den torkelnden Toten nach
langer Abstinenz von der großen Kinoleinwand zu einem Comeback zu
verhelfen.
 Auf innovative Impulse für das seit Jahren schlummernde Subgenre des
Zombiefilms hofft man jedoch bei "Resident Evil" vergeblich. Anderson
mixte sich seinen Horror-Game-Cocktail so seelen- und phantasielos, so
bar jeglicher Spannung und Atmosphäre zusammen, dass das Ergebnis in
weiten Strecken nur zu enttäuschen vermag. Und das zum Teil völlig
unnötigerweise: Einige recht gelungene Einfälle, insbesondere der
visuellen Art, lassen im Ansatz erahnen, was aus "Resident Evil" alles
hätte werden können. So jedoch gelingt es auch Paul Anderson nicht, dass
Dogma, aus einem Computerspiel könne einfach ein gelungener Film
entstehen, zu brechen.
Auf innovative Impulse für das seit Jahren schlummernde Subgenre des
Zombiefilms hofft man jedoch bei "Resident Evil" vergeblich. Anderson
mixte sich seinen Horror-Game-Cocktail so seelen- und phantasielos, so
bar jeglicher Spannung und Atmosphäre zusammen, dass das Ergebnis in
weiten Strecken nur zu enttäuschen vermag. Und das zum Teil völlig
unnötigerweise: Einige recht gelungene Einfälle, insbesondere der
visuellen Art, lassen im Ansatz erahnen, was aus "Resident Evil" alles
hätte werden können. So jedoch gelingt es auch Paul Anderson nicht, dass
Dogma, aus einem Computerspiel könne einfach ein gelungener Film
entstehen, zu brechen.
Dabei hätte der Brite beim Thema Computerspiel gewarnt sein müssen.
Schon 1995 wurde er in der öffentlichen Kritik für seine unterirdisch
schlechte Game-Adaption "Mortal Kombat" förmlich gesteinigt. Während die
heftige Negativkritik über den Nachfolger "Event Horizon" teilweise
übers Ziel hinausschoss, ließ sich für Andersons letzten Film "Star
Force Soldier" nur eine Wertung formulieren: Indiskutabel.
Nun also "Resident Evil" und damit wieder eine Computerspielverfilmung.
Ähnlichkeiten zum 97er "Event Horizon" sind unübersehbar: Auch hier
gerät ein wissenschaftliches Experiment außer Kontrolle, diesmal nicht
im fernen Weltall, sondern in einem weitläufigen, unterirdischen
Forschungslabor ("Hollow Man", "Deep Blue Sea" und Co. lassen natürlich
grüßen), und wieder wird eine kleine Spezialeinheit von
Eliteeinsatzkräften geschickt, um drunten im Höllenschlund nach dem
Rechten zu sehen. Kaum ist das donnernde und leichenträchtige Intro, bei
dem mörderische Viren, Nervengase und herabstürzende Fahrstühle der
wissenschaftlichen Crew des Laboratoriums auf sehr effektvolle Weise den
Garaus machen, verklungen und die Spezialeinheit in die Katakomben
eingedrungen, beginnt sich das Anderson'sche Zitatenkarussell zu drehen:
Verdammt, die Zombies kommen!
 Es wäre müßig, "Resident Evil" vor das Antlitz all jener Vorgänger und
Vorbilder zu zerren, aus denen der Regisseur für seinen subterranen
Untoten-Marathon geschöpft hat. Paul Anderson rekapituliert alle
Mechanismen des altbekannten Motivs von der kleinen Schar, die
abgeschlossen von der Außenwelt in unterirdischen Kavernen um ihr Leben
kämpft. Fleißig gelernt hat er seine Zombie-Lektionen allerdings:
Angefangen von den Standard setzenden Filmen George A. Romeros, über
Lucio Fulci, Lamberto Bava bis zu den jüngeren Untotenstreifen eines
Brian Yuzna und eines Dan O'Bannon. Da ist kaum ein Klischee, welches
uns in "Resident Evil" blutverschmiert und nach Menschenfleisch
schnappend über den Weg watschelt, das nicht in vielfacher Weise in
diversesten früheren (Mach-)Werken des Genres bemüht worden wäre. Dabei
scheint Paul Anderson klar auf das Alter des Zielpublikums zu
spekulieren und darauf, dass diese Zuschauer, von denen viele sich aus
den Reihen der "Resident- Evil"-Spieler rekrutieren dürften, die
meisten Vertreter der besonders schmodderigen Zombie-Welle in den 80ern
kaum mehr kennen dürften.
Es wäre müßig, "Resident Evil" vor das Antlitz all jener Vorgänger und
Vorbilder zu zerren, aus denen der Regisseur für seinen subterranen
Untoten-Marathon geschöpft hat. Paul Anderson rekapituliert alle
Mechanismen des altbekannten Motivs von der kleinen Schar, die
abgeschlossen von der Außenwelt in unterirdischen Kavernen um ihr Leben
kämpft. Fleißig gelernt hat er seine Zombie-Lektionen allerdings:
Angefangen von den Standard setzenden Filmen George A. Romeros, über
Lucio Fulci, Lamberto Bava bis zu den jüngeren Untotenstreifen eines
Brian Yuzna und eines Dan O'Bannon. Da ist kaum ein Klischee, welches
uns in "Resident Evil" blutverschmiert und nach Menschenfleisch
schnappend über den Weg watschelt, das nicht in vielfacher Weise in
diversesten früheren (Mach-)Werken des Genres bemüht worden wäre. Dabei
scheint Paul Anderson klar auf das Alter des Zielpublikums zu
spekulieren und darauf, dass diese Zuschauer, von denen viele sich aus
den Reihen der "Resident- Evil"-Spieler rekrutieren dürften, die
meisten Vertreter der besonders schmodderigen Zombie-Welle in den 80ern
kaum mehr kennen dürften.
Nicht nur das unterirdische Labor, in dem das halbverweste Leichenvolk
zum Halali auf menschliches Frischfleisch bläst, ist bekannt aus "Day of
the dead" (1985). Aus George A. Romeros Abschluss seiner
Zombie-Trilogie wurden mehrere komplette Szenen eins zu eins
importiert. Die militärische Spezialeinheit, die angesichts der
Übermacht von tappsigen Torkel-Toten schnell von Jägern zu Gejagten wird
- alles 1980 schon gehabt in "Inferno dei morti viventi" (und vielen
anderen). Michelle Rodriguez als rotziges Söldner-Babe ist natürlich
nichts anderes als ein verjüngtes Alter Ego von Private Vasquez alias
Jenette Goldstein aus James Camerons "Aliens" (1986). Motive von
allmächtigen, alles steuernden Computerhirnen, wie es hier die "Red
Queen" darstellt, fußen letztendlich alle auf Kubricks "2001". Etwas
jüngeren Datums ist das Laser-Abwehrsystem, mit dem unliebsame Besucher
der Computerzentrale in handliche kleine Würfel geschnitten werden und
welches sich Anderson bei Vincenzo Natalis "Cube" auslieh. Und im
horriblen Finale werden sogar George A. Romeros "Crazies" und Lucio
Fulcis "Zombi 2" bemüht.
 Der reine Vorwurf filmischer Grabräuberei wirkt allerdings weniger
schwer als das, was Paul Anderson aus seinem Zitatengebräu kreierte:
Hätte er aus den diversen, zusammengeklaubten Zutaten ein halbwegs
atmosphärisch stimmiges Stück Horrorkino gezaubert, man hätte ihm das
Abkupfern verzeihen können. Doch "Resident Evil" wirkt größtenteils wie
eine laue Geisterbahnfahrt, bei der sich eine fade Gruselattraktion an
die nächste reiht, ohne dass sich daraus auch eine marginale
Spannungssteigerung extrahieren ließe. "Event Horizon" hatte - trotz
aller hinlänglich bekannten Schwächen und spekulativen Versatzstücke -
so etwas wie eine Atmosphäre, wirkte kompakt, war stellenweise wirklich
unheimlich. Bei "Resident Evil" türmen sich dagegen Monster, Zombies und
Handlungsfragmente wie lose Trümmer aufeinander, ohne sich zu einem
stringenten, homogenen Ganzen zu verdichten. Zudem geht Anderson zum
Finale gnadenlos nach dem Prinzip "höher, schneller, weiter" vor, packt
immer noch ein Monster, noch einen Effekt, noch ein Zitat und noch eine
Actionsequenz ins marktschreierische Untertage-Zombie-Sonderangebots:
Hier noch ein bisschen "Relict", da noch einen Happen "Speed", und
fertig ist die Horror-Fastfood-Tüte zum Mitnehmen für den filmischen
Aldi-Gourmet.
Der reine Vorwurf filmischer Grabräuberei wirkt allerdings weniger
schwer als das, was Paul Anderson aus seinem Zitatengebräu kreierte:
Hätte er aus den diversen, zusammengeklaubten Zutaten ein halbwegs
atmosphärisch stimmiges Stück Horrorkino gezaubert, man hätte ihm das
Abkupfern verzeihen können. Doch "Resident Evil" wirkt größtenteils wie
eine laue Geisterbahnfahrt, bei der sich eine fade Gruselattraktion an
die nächste reiht, ohne dass sich daraus auch eine marginale
Spannungssteigerung extrahieren ließe. "Event Horizon" hatte - trotz
aller hinlänglich bekannten Schwächen und spekulativen Versatzstücke -
so etwas wie eine Atmosphäre, wirkte kompakt, war stellenweise wirklich
unheimlich. Bei "Resident Evil" türmen sich dagegen Monster, Zombies und
Handlungsfragmente wie lose Trümmer aufeinander, ohne sich zu einem
stringenten, homogenen Ganzen zu verdichten. Zudem geht Anderson zum
Finale gnadenlos nach dem Prinzip "höher, schneller, weiter" vor, packt
immer noch ein Monster, noch einen Effekt, noch ein Zitat und noch eine
Actionsequenz ins marktschreierische Untertage-Zombie-Sonderangebots:
Hier noch ein bisschen "Relict", da noch einen Happen "Speed", und
fertig ist die Horror-Fastfood-Tüte zum Mitnehmen für den filmischen
Aldi-Gourmet.
Dass die Darsteller allesamt nur Knallchargen-Niveau bieten,
insbesondere die beiden weiblichen Hauptdarsteller, kann man bei einem
Film dieses Metiers, in denen die meisten Figuren eh nur als Füllstoff
für den genre-typischen Zehn-kleine-Negerin-Abzählreim dienen, nicht
anders erwarten. Insbesondere die ehemalige Johanna von Orleans Milla
Jovovich ist als leichtgeschürzte, kampfstarke Anti-Zombie-Amazone zwar
sehr hübsch anzuschauen, wirkt aber geradezu lächerlich deplaziert.
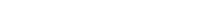 Allein einige Schauwerte sind es, die "Resident Evil" vom Niveau
gängiger Direct-To-Video-Formate abheben. Das Interieur der
unterirdischen Forschungsstation und zahlreiche digitale Effekte haben
tatsächlich internationales Format. Die inhaltlichen Schwächen bilden
dieser generösen Ausstattung gegenüber einen ähnlichen Kontrast wie bei
all jenen amerikanischen Blockbuster Marke "The mummy returns", bei
denen sich stets die Höhe des Special-Effects-Budget umgekehrt
proportional zur Komplexität und zum Sinngehalt der Story verhält.
"Resident Evil" gerät damit tatsächlich zum zelluloidgewordenen Abbild
dessen, worauf sich der Film originär beruft: Eines Computerspieles, bei
dem monoton Monster für Monster, Zombie für Zombie und Level für Level
abgehakt wird. Dass das auch anders und viel besser geht, bewies - zum
Beispiel - Brian Yuzna mit seinem beeindruckenden "Return of the living
dead 3", in dem er die völlig ausgereizt scheinende Zombie-Thematik mit
einem faszinierenden Romeo-und-Julia-Plot verband. Für deutsche
Zuschauer dürfte eine Besetzung in "Resident Evil" für ungeahnte (und
sicherlich auch weitgehend unbeabsichtigte) Heiterkeitsausbrüche in den
Parkettreihen der Multiplexe sorgen: Heike Makatsch als anämische
Untote!
Allein einige Schauwerte sind es, die "Resident Evil" vom Niveau
gängiger Direct-To-Video-Formate abheben. Das Interieur der
unterirdischen Forschungsstation und zahlreiche digitale Effekte haben
tatsächlich internationales Format. Die inhaltlichen Schwächen bilden
dieser generösen Ausstattung gegenüber einen ähnlichen Kontrast wie bei
all jenen amerikanischen Blockbuster Marke "The mummy returns", bei
denen sich stets die Höhe des Special-Effects-Budget umgekehrt
proportional zur Komplexität und zum Sinngehalt der Story verhält.
"Resident Evil" gerät damit tatsächlich zum zelluloidgewordenen Abbild
dessen, worauf sich der Film originär beruft: Eines Computerspieles, bei
dem monoton Monster für Monster, Zombie für Zombie und Level für Level
abgehakt wird. Dass das auch anders und viel besser geht, bewies - zum
Beispiel - Brian Yuzna mit seinem beeindruckenden "Return of the living
dead 3", in dem er die völlig ausgereizt scheinende Zombie-Thematik mit
einem faszinierenden Romeo-und-Julia-Plot verband. Für deutsche
Zuschauer dürfte eine Besetzung in "Resident Evil" für ungeahnte (und
sicherlich auch weitgehend unbeabsichtigte) Heiterkeitsausbrüche in den
Parkettreihen der Multiplexe sorgen: Heike Makatsch als anämische
Untote!
|

seit 24.03.2002

 Impressum.
Impressum.