|
 Wenn der Begriff Mythos, unter dem man landläufig eine Erzählung der
Götter-, Erd- oder Menschheitsgeschichte auf der Grundlage von
Kollektivvorstellungen versteht, für ein Phänomen im Bereich der
Filmbranche angebracht erscheint, dann für George Lucas und seine "Star
Wars"-Filme. Stanley Kubrick war es, der den Science Fiction salonfähig
machte, George Lucas hingegen schmiedete daraus das erfolgreichste
Filmgenre der Welt. Spott und Geringschätzung erntete der damals gerade
einmal dreißigjährige Regisseur, als er Mitte der 70er Jahre diversen
Produktionsfirmen die Idee eines phantasievollen, beinahe kindlichen
Weltraumabenteuers vorstellte. Heute lacht niemand mehr über den
mehrfachen Merchandising-Milliardär, dessen erste Star-Wars-Trilogie
astronomische Summen einspielte und ganze Fan-Generationen von
Jedi-Jüngern und Freizeit-Darth-Vadern hervorbrachte. Die
Science-Fiction-Trilogie ist zum Symbol schlechthin für das Artifizielle
der Popkultur geworden - eine große Assemblage aus Versatzstücken, von
einem dreisten Plünderer aus Märchen und Mythen, aus Filmen und Comics
zusammengeklaubt.
Wenn der Begriff Mythos, unter dem man landläufig eine Erzählung der
Götter-, Erd- oder Menschheitsgeschichte auf der Grundlage von
Kollektivvorstellungen versteht, für ein Phänomen im Bereich der
Filmbranche angebracht erscheint, dann für George Lucas und seine "Star
Wars"-Filme. Stanley Kubrick war es, der den Science Fiction salonfähig
machte, George Lucas hingegen schmiedete daraus das erfolgreichste
Filmgenre der Welt. Spott und Geringschätzung erntete der damals gerade
einmal dreißigjährige Regisseur, als er Mitte der 70er Jahre diversen
Produktionsfirmen die Idee eines phantasievollen, beinahe kindlichen
Weltraumabenteuers vorstellte. Heute lacht niemand mehr über den
mehrfachen Merchandising-Milliardär, dessen erste Star-Wars-Trilogie
astronomische Summen einspielte und ganze Fan-Generationen von
Jedi-Jüngern und Freizeit-Darth-Vadern hervorbrachte. Die
Science-Fiction-Trilogie ist zum Symbol schlechthin für das Artifizielle
der Popkultur geworden - eine große Assemblage aus Versatzstücken, von
einem dreisten Plünderer aus Märchen und Mythen, aus Filmen und Comics
zusammengeklaubt.
 Einmalig in der Filmgeschichte dürfte auch die (selbstverständlich vom
Marketing immer wieder clever geschürte) Beständigkeit des Sternenkults
sein, dem seine Anhänger von 1983 bis 1999 auch ohne Film treu ergeben
blieben. So lange mussten sie ausharren, bis der Rekord-Regisseur von
seinem von Laserschwerten umzäunten und imperialen Sturmtruppen
bewachten Olymp herabstieg und das Lucas-Evangelium nach "Return of the
Jedi" eine Fortsetzung erfuhr. Was George Lucas der Fangemeinde jedoch
1999 unter dem Titel "Episode I - The Phantom Menace" kredenzte,
induzierte bei vielen Star-Wars-Proselyten statt der erwarteten
religiösen Verzückung schlichtes Entsetzen: An Stelle der erhofften
Fortführung des märchenhaften Galaxienmythos' servierte ihnen der
einstige Sternenmagier eine plastikbunte, inhaltlich zwischen
infantil-dämlich und schlicht belanglos oszillierende
Weltraum-Achterbahn mit Playstation-Anspruch, dem Tiefgang eines Stücks
Meteoritenstaub und der Intelligenz eines tatooinischen
Gesteinsbrockens. So lag es allein an George Lucas, mit dem nächsten
Prequel "Episode II - Attack of the Clones" den entstandenen Flurschaden
zu bereinigen.
Einmalig in der Filmgeschichte dürfte auch die (selbstverständlich vom
Marketing immer wieder clever geschürte) Beständigkeit des Sternenkults
sein, dem seine Anhänger von 1983 bis 1999 auch ohne Film treu ergeben
blieben. So lange mussten sie ausharren, bis der Rekord-Regisseur von
seinem von Laserschwerten umzäunten und imperialen Sturmtruppen
bewachten Olymp herabstieg und das Lucas-Evangelium nach "Return of the
Jedi" eine Fortsetzung erfuhr. Was George Lucas der Fangemeinde jedoch
1999 unter dem Titel "Episode I - The Phantom Menace" kredenzte,
induzierte bei vielen Star-Wars-Proselyten statt der erwarteten
religiösen Verzückung schlichtes Entsetzen: An Stelle der erhofften
Fortführung des märchenhaften Galaxienmythos' servierte ihnen der
einstige Sternenmagier eine plastikbunte, inhaltlich zwischen
infantil-dämlich und schlicht belanglos oszillierende
Weltraum-Achterbahn mit Playstation-Anspruch, dem Tiefgang eines Stücks
Meteoritenstaub und der Intelligenz eines tatooinischen
Gesteinsbrockens. So lag es allein an George Lucas, mit dem nächsten
Prequel "Episode II - Attack of the Clones" den entstandenen Flurschaden
zu bereinigen.
 Und tatsächlich ist dem 58jährigen Regisseur mit der insgesamt fünften
und chronologisch an zweiter Stelle angesiedelten Episode seiner
intergalaktischen Eschatologie das nicht zu unterschätzende Meisterstück
gelungen, atmosphärisch die Brücke zum Flair der ersten drei Teile zu
schlagen und zugleich - was nicht anders zu erwarten und für einen
Lucas-Film ohnehin obligat war - tricktechnisch die Pflöcke wieder
einmal meilenweit vor allen Vorgängern einzurammen. Aus Fehlern wird man
bekanntlich klug, und so verzichtete George Lucas vor allem erzählerisch
auf all jene Ingredienzien, die bei "Episode I" insbesondere den
Hardcore-Fans die letzten Sakramente hochkommen ließen: Statt
Nintendo-artiger Videogame-Handlung, geistlosem Recycling von
Uralt-Versatzstücken der ersten drei Filme und verquast-pseudoreligiösen
Mummenschanzes, der in "Episode I" bisweilen mit dem Charme der
Oberammergauer Passionsspiele zelebriert wurde, zauberte George Lucas
auf einmal wieder das, was vor allem den ersten "Star Wars" von 1977 so
liebenswürdig märchenhaft daherkommen ließ: Guten, altmodischen
Abenteuerkintopp.
Und tatsächlich ist dem 58jährigen Regisseur mit der insgesamt fünften
und chronologisch an zweiter Stelle angesiedelten Episode seiner
intergalaktischen Eschatologie das nicht zu unterschätzende Meisterstück
gelungen, atmosphärisch die Brücke zum Flair der ersten drei Teile zu
schlagen und zugleich - was nicht anders zu erwarten und für einen
Lucas-Film ohnehin obligat war - tricktechnisch die Pflöcke wieder
einmal meilenweit vor allen Vorgängern einzurammen. Aus Fehlern wird man
bekanntlich klug, und so verzichtete George Lucas vor allem erzählerisch
auf all jene Ingredienzien, die bei "Episode I" insbesondere den
Hardcore-Fans die letzten Sakramente hochkommen ließen: Statt
Nintendo-artiger Videogame-Handlung, geistlosem Recycling von
Uralt-Versatzstücken der ersten drei Filme und verquast-pseudoreligiösen
Mummenschanzes, der in "Episode I" bisweilen mit dem Charme der
Oberammergauer Passionsspiele zelebriert wurde, zauberte George Lucas
auf einmal wieder das, was vor allem den ersten "Star Wars" von 1977 so
liebenswürdig märchenhaft daherkommen ließ: Guten, altmodischen
Abenteuerkintopp.
 Bekanntermaßen gehört George Lucas zu jenen Erdenmenschen, für die
Religion, Rittertum und Batman nur verschiedene Bezeichnungen für die
gleiche Sache sind. Beflügelt von der ewigen Wiederkehr der Archetypen,
die Joseph Campbell in seinem Buch "The hero with a thousand faces"
postulierte, drehte er 1977 "Star Wars". Sein Held im weißen Wickelhemd
hieß - Skywalker; Vorname: Luke; Beruf: Prinzessinnen-Erretter. Ein
wenig komplexer darf's im postideologischen Zeitalter schon sein, doch
wie vor 25 Jahren gibt es wieder eine berückend schöne Space-Adlige
(Natalie Portman), die von der dunklen Seite der Macht bedroht und von
tapferen, Laserschwert-schwingenden Jedi-Recken (Hayden Christensen,
Ewan MacGregor) gerettet werden muß. Und das bedeutet - ganz im
Gegensatz zum stumpfsinnig und monoton dahinplätschernden Vorgänger -
Action, Action, Action! Noch keine drei Minuten ist der Film alt, als
bereits das erste Raumschiff explodiert ist und der Zuschauer die
Ausmaße der herannahenden Bedrohung zu erahnen beginnt. Und wenn sich
wenig später Hayden Christensen und Ewan McGregor über den
schwindelerregend in Szene gesetzten urbanen Abgründen der
Republikhauptstadt Coruscant eine nervenzerfetzende Verfolgungsjagd mit
einem sinistren Attentäter liefern, sind die Weichen endgültig auf
Dramatik gestellt.
Bekanntermaßen gehört George Lucas zu jenen Erdenmenschen, für die
Religion, Rittertum und Batman nur verschiedene Bezeichnungen für die
gleiche Sache sind. Beflügelt von der ewigen Wiederkehr der Archetypen,
die Joseph Campbell in seinem Buch "The hero with a thousand faces"
postulierte, drehte er 1977 "Star Wars". Sein Held im weißen Wickelhemd
hieß - Skywalker; Vorname: Luke; Beruf: Prinzessinnen-Erretter. Ein
wenig komplexer darf's im postideologischen Zeitalter schon sein, doch
wie vor 25 Jahren gibt es wieder eine berückend schöne Space-Adlige
(Natalie Portman), die von der dunklen Seite der Macht bedroht und von
tapferen, Laserschwert-schwingenden Jedi-Recken (Hayden Christensen,
Ewan MacGregor) gerettet werden muß. Und das bedeutet - ganz im
Gegensatz zum stumpfsinnig und monoton dahinplätschernden Vorgänger -
Action, Action, Action! Noch keine drei Minuten ist der Film alt, als
bereits das erste Raumschiff explodiert ist und der Zuschauer die
Ausmaße der herannahenden Bedrohung zu erahnen beginnt. Und wenn sich
wenig später Hayden Christensen und Ewan McGregor über den
schwindelerregend in Szene gesetzten urbanen Abgründen der
Republikhauptstadt Coruscant eine nervenzerfetzende Verfolgungsjagd mit
einem sinistren Attentäter liefern, sind die Weichen endgültig auf
Dramatik gestellt.
 Kongruent zur viel flüssiger inszenierten und auf Space-Thrill
getrimmten Story erlebt "Episode II" eine um Parsecs vitalere
Darstellerriege als im Vorgängerfilm. Ewan McGregor ist zwar mimisch
immer noch Lichtjahre von der Präsenz seines früheren (und älteren)
Alter Egos Alec Guinness entfernt, scheint aber inzwischen seinen
Frieden mit der Rolle eines Kutten-tragenden Laserschwert-Ritters
gemacht zu haben und weiß sich sogar als Action-Mime in so manchen
Kampfszenen ansprechend in Szene zu setzen. Natalie Portman als Padmé
Amidala ist diesmal nicht nur eine Augenweide, sondern agiert auch viel
lebendiger als in "Episode I", wo sie noch als weißgetünchter
Weihnachtsbaumschmuck weihevoll-nichtssagende Plattitüden zu deklamieren
hatte. Charaktermime Ian McDiarmid bleibt als Supreme Chancellor
Palpatine weiterhin eine Randfigur, strahlt aber inzwischen souverän die
Bedrohung aus, die die kommenden Ereignisse und seine dabei fundamental
entscheidende Rolle erahnen lassen. Der schwerste Part fiel sicherlich
Hayden Christensen mit der Aufgabe zu, dem heranwachsenden Anakin
Skywalker darstellerisches Profil und charakterliche Tiefe zu verleihen.
Und der 21jährige Newcomer absolviert diesen wahrlich nicht einfach
angelegten bravourös: Mit bemerkenswerter Ausdrucksstärke trägt
Christensen die Hybris des heranwachsenden Jedi-Schülers zu Markte und
zu Felde, expliziert dessen innere Zerrissenheit zwischen
Selbstverliebtheit und Pflichterfüllung, zwischen trotzigem Aufbegehren
und anerzogenen Verhaltenskonventionen, zwischen prätentiöser Arroganz
und stoischer Bescheidenheit, zwischen seiner (natürlich nicht
zulässigen) Liebe zu Padmé Amidala und dem Kodex der Jedi-Ritter, im
Freudschen Sinne also zwischen Es und Über-Ich. Ein wenig hölzern und
bemüht wirken allenfalls Anakins Liebesbezeugungen der angebeteten
Senatorin gegenüber, und die krampfhaft hineinpsychologisierte Ursache
für seinen wachsenden Hass auf den ungeliebten Ausbilder Obi-Wan liegt
irgendwo zwischen Groschenheftniveau und Bäckerblume.
Kongruent zur viel flüssiger inszenierten und auf Space-Thrill
getrimmten Story erlebt "Episode II" eine um Parsecs vitalere
Darstellerriege als im Vorgängerfilm. Ewan McGregor ist zwar mimisch
immer noch Lichtjahre von der Präsenz seines früheren (und älteren)
Alter Egos Alec Guinness entfernt, scheint aber inzwischen seinen
Frieden mit der Rolle eines Kutten-tragenden Laserschwert-Ritters
gemacht zu haben und weiß sich sogar als Action-Mime in so manchen
Kampfszenen ansprechend in Szene zu setzen. Natalie Portman als Padmé
Amidala ist diesmal nicht nur eine Augenweide, sondern agiert auch viel
lebendiger als in "Episode I", wo sie noch als weißgetünchter
Weihnachtsbaumschmuck weihevoll-nichtssagende Plattitüden zu deklamieren
hatte. Charaktermime Ian McDiarmid bleibt als Supreme Chancellor
Palpatine weiterhin eine Randfigur, strahlt aber inzwischen souverän die
Bedrohung aus, die die kommenden Ereignisse und seine dabei fundamental
entscheidende Rolle erahnen lassen. Der schwerste Part fiel sicherlich
Hayden Christensen mit der Aufgabe zu, dem heranwachsenden Anakin
Skywalker darstellerisches Profil und charakterliche Tiefe zu verleihen.
Und der 21jährige Newcomer absolviert diesen wahrlich nicht einfach
angelegten bravourös: Mit bemerkenswerter Ausdrucksstärke trägt
Christensen die Hybris des heranwachsenden Jedi-Schülers zu Markte und
zu Felde, expliziert dessen innere Zerrissenheit zwischen
Selbstverliebtheit und Pflichterfüllung, zwischen trotzigem Aufbegehren
und anerzogenen Verhaltenskonventionen, zwischen prätentiöser Arroganz
und stoischer Bescheidenheit, zwischen seiner (natürlich nicht
zulässigen) Liebe zu Padmé Amidala und dem Kodex der Jedi-Ritter, im
Freudschen Sinne also zwischen Es und Über-Ich. Ein wenig hölzern und
bemüht wirken allenfalls Anakins Liebesbezeugungen der angebeteten
Senatorin gegenüber, und die krampfhaft hineinpsychologisierte Ursache
für seinen wachsenden Hass auf den ungeliebten Ausbilder Obi-Wan liegt
irgendwo zwischen Groschenheftniveau und Bäckerblume.
 Das darstellerische Salz in der interstellaren Suppe bilden hingegen vor
allem zwei Figuren: Zum einen Temuera Morrison als Kopfgeldjäger Jango
Fett, Vater des später in der gleichen Branche tätigen und vor allem für
einen gewissen Han Solo so bedeutsamen Boba Fett, dem vielfach der Ruf
der zweitbeliebtesten Schurkenfigur der ersten Trilogie vorauseilte.
Seine Einsätze im altbekannten, mit allerlei Waffen ausgestatteten
Raketenpanzer bieten allein schon die Rasanz und das Tempo, die in
"Episode I" mit Ausnahme des Pod-Rennens so schmerzlich fehlten. Den
Besetzungs-Clou schlechthin liefert George Lucas mit Christopher Lee.
Der mittlerweile 80jährige Charaktermime, als Dracula einst in Diensten
der legendären Hammer-Studios und vor kurzem erst in Peter Jacksons
"Lord of the rings" als Saruman zu sehen, bringt erstmals in der Riege
der "Star Wars"-Bösewichter wieder die Präsenz, das Charisma und die
Aura ein, die den Filmen seit dem Abtritt von der Peter Cushing im
ersten "Star Wars" fehlte. Zweifellos war Cushing, wie Lee ein
ehemaliger Hammer-Star, 1977 in der Rolle des Grand Moff Tarkin der
beste Schurke, den die Serie je erleben durfte - Christopher Lee
verleiht ihm einen würdigen Nachfolger.
Das darstellerische Salz in der interstellaren Suppe bilden hingegen vor
allem zwei Figuren: Zum einen Temuera Morrison als Kopfgeldjäger Jango
Fett, Vater des später in der gleichen Branche tätigen und vor allem für
einen gewissen Han Solo so bedeutsamen Boba Fett, dem vielfach der Ruf
der zweitbeliebtesten Schurkenfigur der ersten Trilogie vorauseilte.
Seine Einsätze im altbekannten, mit allerlei Waffen ausgestatteten
Raketenpanzer bieten allein schon die Rasanz und das Tempo, die in
"Episode I" mit Ausnahme des Pod-Rennens so schmerzlich fehlten. Den
Besetzungs-Clou schlechthin liefert George Lucas mit Christopher Lee.
Der mittlerweile 80jährige Charaktermime, als Dracula einst in Diensten
der legendären Hammer-Studios und vor kurzem erst in Peter Jacksons
"Lord of the rings" als Saruman zu sehen, bringt erstmals in der Riege
der "Star Wars"-Bösewichter wieder die Präsenz, das Charisma und die
Aura ein, die den Filmen seit dem Abtritt von der Peter Cushing im
ersten "Star Wars" fehlte. Zweifellos war Cushing, wie Lee ein
ehemaliger Hammer-Star, 1977 in der Rolle des Grand Moff Tarkin der
beste Schurke, den die Serie je erleben durfte - Christopher Lee
verleiht ihm einen würdigen Nachfolger.
 In den Disziplinen Effekte und Design definiert George Lucas sich erneut
als das Maß aller Dinge. Optisch bietet "Episode II"
Landschaftspanoramen und planetare Impressionen von geradezu
überwältigender Grandezza. Der ungekrönte Magnificus der Set-Kreationen
beginnt sein fünftes Star-Wars-Werk mit den atemberaubenden Kreationen
des präimperialen Hauptstadtplaneten Coruscant, einer ins fast Groteske
übersteigerten architektonischen Metamorphose aus Luc Bessons "The fifth
element" und dem Design der Wachowski'schen Matrix. Die weiteren
Szenerien folgen in lockerer Anlehnung den Ideen des zweiten
Star-Wars-Films "The impire strikes back" - nur um einen visuellen
Höhepunkt von dem nächsten toppen zu lassen: Eine Stadt inmitten eines
von Orkanen durchpflügtern Ozeanplaneten wirkt wie der
morpho-futuristische Gegenentwurf zur Wolkenstadt Bespin, eine furiose
Verfolgungsjagd durch ein Asteroidenfeld rekapituliert - wenn auch nur
kurz - Hans Solos berühmten Asteroidenflug, und im Finale gibt es
zahlreiche Reminiszenzen an die Schlacht auf dem Eisplaneten Hoth. Dazu
kommen Landschaftsimpressionen vom Planeten Naboo mit den wohl
betörendsten und schwelgerischsten Postkartenmotiven diesseits des
Andromeda-Nebels. Das fulminante Finale, das wiederum Schlachten zu
Lande und in der Luft mit rasanten Laserschwert-Duellen kombiniert,
bietet Kinetik am Limit inszenatorischer Möglichkeiten. Für den wie
immer kongenialen Score zeichnete ein fünftes Mal John Williams
verantwortlich.
In den Disziplinen Effekte und Design definiert George Lucas sich erneut
als das Maß aller Dinge. Optisch bietet "Episode II"
Landschaftspanoramen und planetare Impressionen von geradezu
überwältigender Grandezza. Der ungekrönte Magnificus der Set-Kreationen
beginnt sein fünftes Star-Wars-Werk mit den atemberaubenden Kreationen
des präimperialen Hauptstadtplaneten Coruscant, einer ins fast Groteske
übersteigerten architektonischen Metamorphose aus Luc Bessons "The fifth
element" und dem Design der Wachowski'schen Matrix. Die weiteren
Szenerien folgen in lockerer Anlehnung den Ideen des zweiten
Star-Wars-Films "The impire strikes back" - nur um einen visuellen
Höhepunkt von dem nächsten toppen zu lassen: Eine Stadt inmitten eines
von Orkanen durchpflügtern Ozeanplaneten wirkt wie der
morpho-futuristische Gegenentwurf zur Wolkenstadt Bespin, eine furiose
Verfolgungsjagd durch ein Asteroidenfeld rekapituliert - wenn auch nur
kurz - Hans Solos berühmten Asteroidenflug, und im Finale gibt es
zahlreiche Reminiszenzen an die Schlacht auf dem Eisplaneten Hoth. Dazu
kommen Landschaftsimpressionen vom Planeten Naboo mit den wohl
betörendsten und schwelgerischsten Postkartenmotiven diesseits des
Andromeda-Nebels. Das fulminante Finale, das wiederum Schlachten zu
Lande und in der Luft mit rasanten Laserschwert-Duellen kombiniert,
bietet Kinetik am Limit inszenatorischer Möglichkeiten. Für den wie
immer kongenialen Score zeichnete ein fünftes Mal John Williams
verantwortlich.
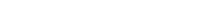 Auch narrativ greift George Lucas auf das Konzept von "The empire
strikes back" zurück, indem er den Plot am Anfang in zwei separate
Handlungsfäden aufspinnt, diese über diverse Planeten und Sternensysteme
bewegt, um sie in einem elektrisierenden Schlussakkord wieder
zusammenzuführen. Es ist seinem inszenatorischen Geschick zuzuschreiben,
dass er der nicht allzu komplexen Handlung, in der überdies gegen Ende
logische Krater von der Größe eines durchschnittlichen Spiralnebels,
Handelsklasse A, klaffen, einige markante Spannungsmomente abgewinnen
kann. Und das, obwohl alle drei Star-Wars-Filme der neuen Trilogie mit
der Hypothek des Prequels belastet sind: Das Schicksal der meisten
handelnden Personen ist auf Grund ihres (chronologisch späteren)
Wiedererscheinens in der ersten Trilogie determiniert. Einem Obi-Wan
Kenobi oder einem Anakin Skywalker kann eben schlicht nichts wirklich
Gravierendes zustoßen - wie sollten sie sonst einige Jahrzehnte später
im Todesstern über den Trümmern des Planeten Alderaan wieder
aufeinandertreffen können? Neben Reliquien aus dem eigenen filmischen
Tabernakel inklusive einer Anspielung auf den Todesstern bedient sich
George Lucas diesmal noch unbekümmerter im Fundus der Film- und
Literaturhistorie: Neben Motiven des Westerns und des Vietnamkriegfilms
werden diesmal unter anderem sogar "Quo vadis" und Isaac Asimovs
Foundation-Trilogie zum interstellaren Stelldichein gebeten.
Auch narrativ greift George Lucas auf das Konzept von "The empire
strikes back" zurück, indem er den Plot am Anfang in zwei separate
Handlungsfäden aufspinnt, diese über diverse Planeten und Sternensysteme
bewegt, um sie in einem elektrisierenden Schlussakkord wieder
zusammenzuführen. Es ist seinem inszenatorischen Geschick zuzuschreiben,
dass er der nicht allzu komplexen Handlung, in der überdies gegen Ende
logische Krater von der Größe eines durchschnittlichen Spiralnebels,
Handelsklasse A, klaffen, einige markante Spannungsmomente abgewinnen
kann. Und das, obwohl alle drei Star-Wars-Filme der neuen Trilogie mit
der Hypothek des Prequels belastet sind: Das Schicksal der meisten
handelnden Personen ist auf Grund ihres (chronologisch späteren)
Wiedererscheinens in der ersten Trilogie determiniert. Einem Obi-Wan
Kenobi oder einem Anakin Skywalker kann eben schlicht nichts wirklich
Gravierendes zustoßen - wie sollten sie sonst einige Jahrzehnte später
im Todesstern über den Trümmern des Planeten Alderaan wieder
aufeinandertreffen können? Neben Reliquien aus dem eigenen filmischen
Tabernakel inklusive einer Anspielung auf den Todesstern bedient sich
George Lucas diesmal noch unbekümmerter im Fundus der Film- und
Literaturhistorie: Neben Motiven des Westerns und des Vietnamkriegfilms
werden diesmal unter anderem sogar "Quo vadis" und Isaac Asimovs
Foundation-Trilogie zum interstellaren Stelldichein gebeten.
 Fazit: Der Patient Star Wars ist mitnichten schwer krank, wie man nach
der blamablen "Episode I" befürchten musste. Auch wenn die
Zugeständnisse an Kommerz, Massengeschmack und inhaltliche Political
Correctness nicht zu übersehen sind, besitzen sie diesmal nicht
annähernd so viel träge Masse, um damit eine wunderschön altmodische,
aber fulminant inszenierte Liebes- und Abenteuergeschichte zu ersticken.
George Lucas scheint den galaktischen Groove wiedergefunden zu haben:
It's only Rock'n'Roll but I like it!
Fazit: Der Patient Star Wars ist mitnichten schwer krank, wie man nach
der blamablen "Episode I" befürchten musste. Auch wenn die
Zugeständnisse an Kommerz, Massengeschmack und inhaltliche Political
Correctness nicht zu übersehen sind, besitzen sie diesmal nicht
annähernd so viel träge Masse, um damit eine wunderschön altmodische,
aber fulminant inszenierte Liebes- und Abenteuergeschichte zu ersticken.
George Lucas scheint den galaktischen Groove wiedergefunden zu haben:
It's only Rock'n'Roll but I like it!
|

seit 13.05.2002

 Impressum.
Impressum.